„Ein gesunder Boden dankt mit Ertrag“
Liebe Teilnehmer des Bodentags,
wir hoffen, dass Ihr wohlbehalten und mit positiven Eindrücken zu Hause angekommen seid. Solltet Ihr Wünsche oder Anregungen zum nächsten Bodentag haben, bitte melden. Hier der Pressebericht zum Bodentag und einige Erinnerungsfotos.
Mutter Natur hilft den Bauern in Trockenphasen und bei Spätfrostgefahr
Dritter Bodentag bei Christbaum Klug in Mittelsinn mit Neuigkeiten und Tipps für die Grüne Branche
Neben Hans Koch, der die Grundzüge des Bodenmanagements erläuterte und einen Schwerpunkt dieses Mal auf die Kohlendixoid-Problematik legte, beteiligten sich eine Reihe weiterer Referenten am diesjährigen Bodentag. Dr. Andreas Wrede, der Leiter des Fachbereichs Versuchswesen Gartenbau und Baumschule der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Ellerhoop, referierte über die Grundlagen der Düngung und berichtete über aktuelle Versuche mit Forstpflanzen im Freiland und im Container. Wie zuvor schon Hans Koch zitierte Wrede das 200 Jahre alte Minimumgesetz von Carl Sprengel und Justus von Liebig, demzufolge der am knappsten vorhandene Nährstoff das Pflanzenwachstum begrenzt, es folglich sinnlos oder sogar schädlich ist, mit einer Düngung andere Nährstoffe zuzuführen. Ebenso wichtig für die Pflanzennährstoffe ist der Säuregehalt des Bodens – er beeinflusst, ob die Stoffe für die Pflanzen verfügbar sind. Dies gilt auch für die Bodenart, also ob zum Beispiel sandig oder tonig.
Mangelversorgung erst nach Jahren sichtbar
Überraschend für manche Zuhörer des Vortrags war ein Versuchsergebnis, demzufolge eine „Nadeldüngung“ ähnlich der im Gartenbau praktizierten Blattdüngung keinen sichtbaren Effekt habe. Ein anderer bemerkenswerter Versuch der schleswig-holsteinischen Landwirtschaftskammer legt die Vermutung nahe, dass Nordmanntannen offenbar dem Boden bis in 90 Zentimeter Tiefe übers Jahr allen Stickstoff entziehen und es speichern, und dies, ohne ein auffälliges Wachstum zu zeigen. Praktisch bestätigt hat die Kammer die Wirkung von Untersaaten: Die Kleesaaten-Mischung von Hans Koch sei eine „Stickstoff-Bombe“; sie bringe auf natürlichem Wege enorme Mengen Stickstoff aus der Luft in den Boden, mehr als dreimal so viel, wie bei praxisüblicher Wirtschaftsweise ohne Untersaaten.
Nur nicht sauer werden
Da es in den Nächten vor dem Bodentag weithin Nachtfrost in Deutschland gab und Spätfrost den Neuaustrieb absterben lässt, stellten die Weihnachtsbaumanbauer dem „Grünlandpapst“ Koch einige Fragen dazu. Unbedeckter dunkler Boden nimmt die Sonneneinstrahlung besser auf als eine Pflanzendecke, speichert die Wärme und strahlt sie nachts wieder ab. Diese Erfahrung stimme, so der Agraringenieur, doch sei der offene Boden erosionsgefährdet, nehme schlecht Wasser auf und könne sich (im Sommer) so stark erhitzen, dass das gesamte Bodenleben abstirbt. Besser sei es, die Pflanzendecke ganzjährig geschlossen zu halten und den Effekt der Wärmespeicherung nachzubilden: Indem die Pflanzendecke eingeschnitten und mit waagrechten Pflugscharen in geringer Tiefe unterschnitten wird, quasi wie Rollrasen. Das bewirkt, dass der Bewuchs braun wird, die Begleitpflanzen aber aus dem Wurzelwerk wieder austreiben werden. Günstige Nebeneffekte dabei sind die verbesserte Aufnahmefähigkeit von Niederschlägen und die vorübergehend gestoppte Verdunstung der Bodenfeuchte über die Pflanzen.
Brandneu: Flüssigmulch
Um Feld- und Wühlmausplagen vorzubeugen, gab Koch den Landwirten den Tipp, für Greifvögel Sitzstangen aufzustellen: eine 50 Zentimeter breite runde Querstange auf einen
drei Meter hohen Mast. Dies sei die effektivste Methode, der vermehrungsfreudigen Nager Herr zu werden. Ein Mäuseweibchen könne alle 20 Tage drei bis acht Junge gebären, die ihrerseits bereits nach 13 Tagen geschlechtsreif sind.
Wassermanagement mit Gelee
Neue Forschungsergebnisse zum steigenden Gehalt des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre präsentierte Hans Koch. Humus und Pflanzen seien zwar gute Kohlendioxid-Verwerter, könnten es jedoch nur aufnehmen, wenn ausreichend Feuchtigkeit gegeben ist und: Bei Temperaturen über 30 Grad schließen Blätter und Nadeln die Spaltöffnungen, sodass sie kein Kohldioxid mehr „atmen“. Aus dem Grund hätten die deutschen Wälder in den Jahren 2017, 2018 und 2021 durch Hitzewellen in Kombination mit Trockenheit eine negative Kohlendioxid-Bilanz gehabt, also mehr CO2 abgegeben als aufgenommen. Ein Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur um ein bis zwei Grad könne bei Mais und Weizen den Ertrag halbieren. Stellenweise sei daher auch Heu von derart schlechter Qualität, dass es Pferde nicht mehr vertragen.
Mit dem Online-Landhandel Agriconomie DE GmbH (Würzburg) stellte Diyaa Tarabeh beim Bodentag eine Alternative bzw. Ergänzung zu den stationären Lagerhäusern vor. Unter www.agriconomie.de kann die Grüne Branche im Internet alle möglichen Produkte bestellen und sich liefern oder zur Abholung an das Lagerhaus vor Ort schicken lassen. Matthias Bredenpohl, Geschäftsführer der Würzburger Firma Matterstock GmbH, präsentierte zum Freischneiden junger Weihnachtsbäume einige Mähmaschinen, die in einer Kultur von Christbaum Klug erprobt werden konnten.
Kontakt für Rückfragen:
Uwe Klug, Tel.: 0179/45 47 40 8
Michael Fillies, Tel.: +49 176/41765087

Juniorchef Finn Klug demonstriert einen Aufsitzmäher

Uwe Klug und Hans Koch

Anbaugerät zum Unterschneiden

Unterschnittener Boden

Hans Koch erklärt die Effekte eines unterschnittenen Bodens

Dr. Andreas Wrede (rechts) beim Vortrag

Alexander Rausch, Vertriebsleiter der Green Legacy GmbH

pH-Wert-Messung













Söder im Christbaumdorf: Mittelsinn eröffnet die Weihnachtszeit
Ministerpräsident Markus Söder eröffnet Christbaumsaison in Mittelsinn

saison.
Foto: Mainpost

ca. 2 Mio. Bäume.
v.l. Landtagsabgeordneter Thorsten Schwab, Ministerpräsident Markus Söder, Bayerische Christbaumkönigin Sina Klug, Landrätin Sabine Sitter, Vorsitzender des Vereins Christbaumdorf Mittelsinn e.V. Uwe Klug, Bügermeister von Mittelsinn Dirk Schiefer.
Foto: Mainpost

Foto: Mainpost
Das Grußwort unserer Christbaumkönigin
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Weihnachtsbaumanbauer,
was wäre Weihnachten ohne einen Weihnachtsbaum? - eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann, da ich in unserem Familienbetrieb mit Bäumen und Schnittgrün aufgewachsen bin. Ich habe die nächsten zwei Jahre die Ehre, den bayerischen Christbaum repräsentieren zu dürfen, und freue mich schon sehr auf meine Amtszeit und die Termine, welche ich wahrnehmen darf.
Zu meiner Person: Ich heiße Sina Klug, bin 18 Jahre alt und absolviere gerade eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten. Der Betrieb meiner Eltern, die Christbaum Klug eGbR, befindet sich in dem ersten Christbaumdorf Deutschlands, in Mittelsinn im bayerischen Spessart. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meinem Pferd und meinen Freunden.
Mein besonderer Dank gilt dem Verein „ Bayerische Christbaumanbauer e. V.": Vielen Dank für Euer Vertrauen! Mein Wunsch für meine Amtszeit ist es, unsere Bevölkerung vom natürlichen Christbaum, der in der Heimat gewachsen ist, zu überzeugen.
Ich freue mich auf zwei ereignisreiche Jahre.
Sina Klug
Bayerische Weihnachtsbaumkönigin

Einige Impressionen der Inthronisierung auf der 29. internationalen Weihnachtsbaumbörse






Umfirmierung zur Christbaum Klug eGbR
Sämtliche Geschäftsbedingungen, sowie Anschrift und Kontonummern bleiben unverändert gültig, lediglich der Firmenname hat sich geändert.


1. Preis „Taspo Award 2023“
In diesem Jahr wurden insgesamt 113 Konzepte in 15 Kategorien für den Taspo Award eingereicht. Wir waren mit 14 Teilnehmern in der einreichungsstärksten Kategorie
„Bestes Konzept Umwelt und Nachhaltigkeit“ dabei.
Unser Familienbetrieb wurde für unser Pilotprojekt des Einsatzes von Untersaaten in Weihnachtsbaumkulturen mit dem Ziel Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit zu vereinen, als erster Weihnachtsbaumproduzent mit einem Taspo Award ausgezeichnet.
In dem europaweit einzigartigen Pilotprojekt versuchen wir "Klimalandwirtschaft" im Weihnachtsbaumanbau umzusetzen. Durch ausgewählte Untersaaten verzichten wir inzwischen weitestgehend auf Herbizide und Mineraldünger. Die Untersaaten binden Kohlendioxid und halten die Bodenfeuchte in trockenen Jahren. Speziell unsere Hanglagen werden durch die Untersaaten besser vor Abschwemmung bei Starkregen
geschützt. Zudem fördern sie das Bodenlebewesen und erhöhen die Artenvielfalt.
Wir bedanken uns bei der Jury und der Taspo für diese Auszeichnung.
Unser ausdrücklicher Dank gilt aber auch Hans Koch vom Landwirtschaftlichen Agraringenieurbüro für Bodensystemleistungen Koch (LaWiBeKo) und dem Bodenkundler und Bodenschätzer Dieter Knakowski, die uns bei diesem Pilotprojekt von Beginn an begleiten.
Genauso gilt unserer Dank Michael Fillies und all unseren Mitarbeitern für ihren Einsatz.








Neueste Erkenntnisse auf unserem Feldtag 2023:
Wie Bodenkundler mit dem Klimawandel umgehen
Die Agraringenieure Dieter Knakowski (Schöllkrippen) und Hans Koch (Hallstadt) sehen in der Landwirtschaft die Lösung vieler Probleme, die sie auf unserem Betrieb eindrucksvoll erläuterten.
Dauerbegrünung sowie Kalk, Kalk und nochmals Kalk – mit diesem Ratschlag an die Landwirte, Gärtner und Winzer ist sich der Bodenkundler aus Schöllkrippen mit seinem Kollegen Hans Koch aus Hallstadt bei Bamberg einig. Der 59-Jährige erforscht seit Jahrzehnten die Abläufe im Boden und gilt im Landbau als Spezialist für Unter- bzw. Beisaaten. Die beiden Agraringenieure lernten sich erst auf diesem Feldtag kennen. Dass sie weitgehend für dieselben Maßnahmen zur Bodenverbesserung und Klimaresilienz werben, schien auch Skeptiker unter den Zuhörern zu überzeugen. Dabei entsprechen viele Maßnahmen den Anbaumethoden früherer Zeiten, als es noch keine großen Landmaschinen und ausgefeilte Kunstdünger gab. Mit dem unbegrenzt verfügbaren und billigen Kalk dem Wasserhaushalt und dem Leben im Boden und damit der Fruchtbarkeit auf die Sprünge zu helfen, ist seit Jahrhunderten üblich.
Folgen des Klimawandels mildern
Dieter Knakowski spricht von der Regenverdaulichkeit des Bodens. Er berechnete die Wasserspeicherfähigkeit des kargen Hangs an unserem Bergsee mit 80 Liter je Kubikmeter, wenn er begrünt ist. Die Menge ließe sich kurzfristig durch Kalkgaben und den weiteren Verzicht auf Pflügen und Eggen um fünf Liter steigern. Die allerbesten Böden können sogar 200 Liter aufnehmen. So ein Spitzenwert allerdings lässt sich im Buntsandstein-Verwitterungsgebiet des Spessarts nicht annähernd erreichen. Der Grund dafür ist der hohe Säuregehalt der Erde. Die 20 bis 25 Zentimeter hohe Humusschicht hat einen pH-Wert von 5,5 bis 5 (7 ist der Neutralwert). Darunter, in der Spessart-typischen Braunerde, steigt der Säuregehalt bis in 80 Zentimeter Tiefe auf 4 an. Diese Schicht ist noch durchwurzelbar und es finden sich die wichtigen Bodenlebewesen wie der Regenwurm. Darunter jedoch steigt der Säuregehalt auf 3,8 bis 3,5, was weder Pflanzen noch Tiere vertragen. Der hohe Wert erklärt sich laut Knakowski mit dem Eintrag des sauren Regens in den 1960er Jahren.
Damit das Wasser im Boden bleibt
Beide Referenten raten allen Landwirten zu regelmäßigen Untersuchungen ihrer Standorte. Dies gibt Aufschluss, welche Mineralien gegebenenfalls zugeführt werden müssen. Ob Kalk fehlt, könne der Bauer auch leicht selbst feststellen: etwas zehnprozentige Salzsäure aus der Apotheke auf die blanke Erde – schäumen die Tropfen auf, ist genug Kalk frei verfügbar. Ob allerdings eine Bodensanierung nötig ist, könne nur eine Grabung von einem Meter Tiefe zeigen. Für unsere Christbaumkultur lautete die Empfehlung, einmalig drei Tonnen kohlensauren Kalk je Hektar auszubringen und dann jährlich eine Tonne. Der Kalk sickert über die Jahre ein und repariert so auch den säuregeschädigten Boden in der Tiefe. Eine Tonne Kalk kostet Hans Koch zufolge etwa 50 Euro.
Dienende Pflanzen
Laut Dieter Knakowski schwemmen in Hanglagen zehn Tonnen Erde je Hektar und Jahr ab – dieser natürliche Erosionsprozess sei nur mit gut durchwurzelten Humusböden zu begrenzen, die nach Möglichkeit zusätzlich durch eine Mulchschicht geschützt sind. Die Bodenbearbeitung mit Pflug und Egge sieht der 66-Jährige, selbst gelernter Landwirt, generell kritisch, denn sie belüftet den Boden mit Sauerstoff, was Kompost und Humus abbaut. Dienende Pflanzen, so sein Kollege Koch, können mit ihren Wurzeln das Erdreich gründlicher und tiefer lockern als jede Maschine. Überdies verdrängen sie Unkräuter. So haben wir beispielsweise im Gegensatz zu früher kaum noch Probleme mit dem Weidenröschen, das Pilzkrankheiten auf Nadelbäume überträgt. Über die Interessengemeinschaft der Jungweihnachtsbaumanbauer (IGW) forscht die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein zum Untersaaten-Einsatz; Hans Koch hofft, dass sich auch in Bayern, Baden-Württemberg oder Österreich amtliche Stellen damit befassen werden.

Dieter Knakowski erklärt die Bodenschichten

Hans Koch demonstriert die Säureregulierung durch Kalk
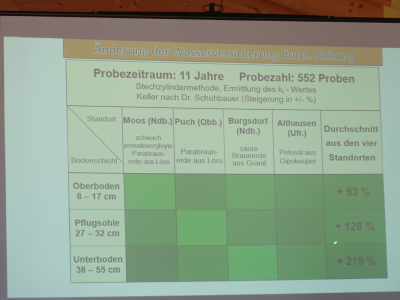
Kalkung steigert die Humusbildung und damit den Ertrag und die Wasseraufnahmefähigkeit der Böden enorm




Interessante Vorführung auf unserem Feldtag 2023
Schon häufiger konnte man die „Riesendrohne“, die wie ein Ufo anmutet, über Mittelsinn fliegen sehen.
Dieses Mal war sie ein weiterer Programmhöhepunkt unseres Feldtages. Nach den Ausführungen des Bodenkundlers und Bodenschätzers Dieter Knakowski und Hans Koch vom Landwirtschaftlichen Agraringenieurbüro für Bodensystemleistungen Koch (LaWiBeKo, München) stellte Drohnenpilot Manuel Ursel (agrar-copter.de, Bergtheim/Unterfranken) eines der größten Fluggeräte dieser Art in Deutschland in unseren Kulturen vor.
Diese Drohnen haben erst im Januar 2022 die Zulassung für den Flugbetrieb erhalten. Auf sechs bis acht Hektar pro Stunde können sie Saatgut, Dünger, auch Flüssigdünger, ausbringen. Im Weinbau sind auch Pflanzenschutzmittel zugelassen. Wie Manuel Ursel erläuterte, koste seine Drohne etwa 40.000 Euro. Sie verfügt über ein 360-Grad-Radar und weiche somit allen Hindernissen zuverlässig aus. Die Flugzeit beträgt nur zehn Minuten, dann müssen der Akku gewechselt und der Saatgut-Tank aufgefüllt werden.

Hans Koch und Manuel Ursel befüllen die Drohne mit der für unseren Boden speziell zusammengestellten Zwischenfrucht. Die Drohne mit einer Arbeitsbreite von 7 m, einer Arbeitsleistung von bis zu 8 ha/Std. ist 80 kg schwer, davon sind 30 kg Nutzlast.

Drohnenpilot Manuel Ursel demonstriert dem Fachpublikum die programmierte Flugbahn in Schleifen quer zum Hang. Wenn die Akkus mit Strom aus Pflanzenöl geladen werden, verläuft der ganze Prozess CO₂-neutral.

Das zukünftige „technische Team“ in unserem Christbaumanbau: Eine Drohne zur Ausbringung von Untersaaten und Dünger und unser Portaltraktor zur Pflege der Untersaaten

Hans Koch demonstriert die starke Bodendurchwurzelung durch „dienende Pflanzen“. Pro Quadratmeter haben sich bis zu 800 Pflanzen angesiedelt, darunter zahlreiche „Bienenpflanzen“.

Voraussetzung aller Maßnahmen sind wiederkehrende Bodenproben. 70 verschiedene Bodenarten in Deutschland erfordern unterschiedliche Mischungen von Untersaaten.

Unser neuester Versuch: Gequetschte Leguminosen, die wir in diesem Frühjahr als biologischen Düngerersatz erstmalig getestet haben. Eine mögliche Alternative bei einer Vervierfachung des Düngemittelpreises.
Christbaumanbau, -ernte und Klimaeinflüsse im Film
TV Mainfranken und ServusTV interessierten sich für die Christbaumernte selbst, für Pflegetipps für den Verbraucher, aber vor allem für die aktuellen Klimaprobleme, die auch vor Christbaumanbauern
keinen Halt machen.
Das Team von ServusTV interviewte dazu Bürgermeister Dirk Schiefer, der sich um die zahlreichen Weihnachtsbaumanbauer und deren Familien in Mittelsinn sorgt. Auch Krimiautor Tino Filippi, der bereits einen Christbaum-Krimi geschrieben hat, äußerte sich besorgt über den Klimaeinfluss in unserer Christbaumregion im Spessart.
Die Filmteams besuchten unseren Betrieb, um sich in der Praxis den Verlauf der Ernte anzusehen. Im Fokus standen jedoch insbesondere die Folgen der beiden Dürreperioden und die Maßnahmen, mit denen wir versuchen, den Klimaveränderungen im Anbau entgegenzuwirken.

